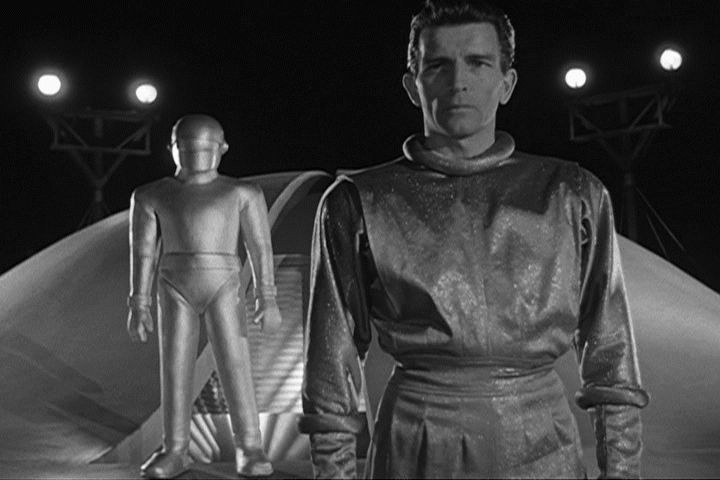Heute ging das Open Air Kino Ciné au Lac in Richterswil zu Ende. Sie hatten eine schlechte Woche erwischt – wer denkt schon, dass es im Sommer einfach mal mehr regnet als scheint. Auf jeden Fall war es schön, dass gerade zum letzten Film das Abendwetter wenigstens trocken war.
So habe ich den Film Le Concert sehen können. Der ist zwar schon aus dem Jahre 2009, doch ich kannte ihn nicht. Von der Beschreibung her klang es wie "Blues Brothers, auf russisch und in Klassik". Da mir Musikfilme, nicht Musicals, immer gefallen und Tschaikowski auch zu meinen gern gehörten Komponisten zählt, fand ich die Beschreibung anziehend genug, um trotz Kälte hinzugehen.
Die Storyline ist denn auch blueshaft, in jeder Beziehung. Zwar kommt da keiner aus dem Knast, aber wohnt in einem Landesknast, der allerdings seit Gorbatschow offener ist: Russland. Dort wurde vor 30 Jahren von Breschnew das höchstangesehene Bolschoi-Orchester zerschlagen, die Starviolinistin Lea mit ihrem Mann nach Sibirien geschickt, wo beide dann nacheinander starben – Lea erst nach vielen Jahren des Durchhaltens, indem sie nur im Kopf und Geiste Tschaikowskis Violinkonzert immer und immer wieder in Variationen spielte.
In Moskau ist derweil der ehemalige Dirigent des berühmten Bolschoi-Orchesters Andrey Filipov zum Hauswart des Bolschoi-Theaters abgestiegen, der sich ab und an noch beim ebenfalls aktuellen Orchesters in der Tribüne aufhält und sich in seine Vergangenheit versetzen lässt. Als bei ihm das Handy während der Probe klingelt, wird er vom Chef zusammengeschissen und muss dessen Büro putzen. Als er da zugange ist, kommt ein Fax rein, den er natürlich liest. Darin wird das Orchester als Ersatz für ein amerikanisches nach Frankreich eingeladen. Der Hauswart schnappt sich den Fax, und es beginnt die Phase des Zusammensuchens der ehemaligen Musiker. Die leben mehr schlecht als recht irgendwo in Moskaus Umgebung in den verschiedensten Berufen. Darunter auch zweifelhafte.
Der ehemalige, stockkommunistische Orchestermanager, der ehedem Andrey mitten in einer Aufführung unterbrach und sein Orchester zerschlug und Andrey mithin ein Trauma verpasste, muss aktiviert werden, weil nur der französisch kann – und eben ein Topmanager war. Als sie das Programm planen, schlägt Andrey daher auch wieder Tschaikowski vor. Der Manager weiss um den Verfall des Orchesters und will daher eine Galeonsfigur als Solistin haben. Er schlägt die junge Anne-Marie Jaquet vor, die gegenwärtig zur Crème de la Crème gehört. Als diese später vom Wunsch des Bolschoi-Orchesters nach ihr erfährt, will sie unbedingt unter dem Maestro Andrey Filipov spielen.
Es ist wohl schon klar, dass es klappen wird, das ist wie bei den Blues Brothers. Der Weg dorthin ist recht amüsant. Der Film nimmt so ziemlich alle religiösen und andere Klischees auf und bringt sie amüsant zur Geltung. Es ist ja klar, dass in Moskau die abgestiegenen Musiker kein Geld übrig haben. Also muss unter anderem ein Sponsor her. Den finden sie auf einer Hochzeitsparty mit Komparsen. Dort brüskiert ein Neureicher mit 1000 Hochzeitsgästen einen anderen Neureichen, der ehedem nur 500 Gäste hatte, indem er ihn, der leidlich Cello spielt, auf die Bühne holt, ihn zum Spielen animiert und dann mit einer E-Gitarre üblen Lärm dazu erzeugt. Es kommt bei dem Anlass vor lauter Saufen, Drogen und leichten Mädchen zu einer Ballerei übler Sorte, in deren Tohuwabohu der Orchestermanager den blamierten Cellisten immerhin als Sponsor für das Orchester gewinnt. Fast sowas wie ein Mäzen also, der später im Film sich aber wieder als abgebrühter Abzocker auftaucht, dem Orchester aber immerhin die Flüge nach Paris zahlt.
Andere jedoch müssen die Visa zur Ausreise besorgen. Dies übernimmt eine Sippe von Roma, von denen einer eben auch als erster Geiger im Orchester spielte. Auch diese Klischees werden amüsant ausgespielt. Der Geiger konnte die Pässe zwar nicht vor dem Abflug organisieren, aber immerhin noch rechtzeitig und direkt in den Wartesälen des Flughafens. Seine Sippe spielt dort Zigeunermusik und klebt und fälscht dabei gleich die Pässe, für die jeder Musiker erst jetzt sein Portraitfoto abgeben muss. Kinder, Opas und Frauen kleben und stempeln dann grad die Pässe. Kommt ein russischer Polizist mit hoher Mütze, stehen dem plötzlich zwei ziemlich massige Zigeuner zur Seite, denen man nicht im Dunkeln begegnen möchte, und säuseln ihm humorlos ins Gesicht "Willst Du eine Massage" oder "Soll ich dir die Zukunft voraussagen". Der zieht sich selbstredend ohne Worte zurück.
So klappt die Reise also nach Paris. Dort setzen sich die Musiker natürlich ab und wollen nichts mehr mit den anderen zu tun haben – SMS, die sie auf die irgendwie illegal erhaltenen Handies bekommen, werden regelmässig ignoriert. Der Dirigent, dem es um etwas ganz anderes geht, um die hehre Musik nämlich, kriegt kalte Füsse, denn natürlich lachen ihn alle Produzenten, Vertragspartner aus oder bekritteln ihn, bzw. er merkt, dass die Mitmusiker sich einen Deut um die Musik kümmern. Das einladende Haus sieht die Musiker erst einen Tag vor dem grossen Auftritt. Dem hat es auch nur aus monetären Gründen zugesagt – weil der Ruhm des alten Bolschoi-Orchesters über die 30 Jahre noch bis in die Gegenwart hineinreicht und vor allem, weil die junge Starviolinistin eben als Zugpferd hinhält – und die alten Russen nebst Gage des Stars immer noch billiger kommen als die Amis. So übersehen sie zähneknirschend die Ausflüge der Moskowiter. Die machen bereits Geschäfte, haben sich bei Verwandten abgesetzt etc.
Allerdings kennen alle diese Musiker die Story von Lea, die ja eine von ihnen war. Als der Tag X kommt, wird das SMS rumgeschickt „Kommt für Lea" - und sie kommen alle aus den Verstecken. Zwei Trompete spielende Juden, Vater und Sohn, die klischeegemäss zuerst geschmuggelten russischen Kaviar verhökern wollen, den aber niemand will, dann umsatteln auf chinesische Billig-Handies, die sie dann ganz locker wegkriegen, kommen gar zu spät ins Orchester, mitsamt Bagage.
Immerhin hatte der Roma-Geiger die lokal ansässigen Roma-Sippen aktiviert, auf dass diese den Musikern Kleider und Instrumente besorgen – denn im sozial kalten Moskau mussten viele alles Wertvolle verkaufen.
Das Haus ist voll – auch da mit Seitenhieben auf unkundiges, empor geschwemmtes, aber reiches Buffet-Abgraser-Publikum. Die junge Anne-Marie ist bereit, Andrey steht vor seinem alten Top-Orchester und es beginnt. Die ersten Takte scheinen nicht zu harmonieren, das merken nicht nur die Musiker, sondern auch die sich von der Unfähigkeit der alten Russen bestätigt fühlenden Franzosen. Auch das Publikum erheitert sich eher als ehrfürchtig zu lauschen. Dann beginnt Anne-Maries Part.
Wie Andrey ihr in einem nostalgischen Abendessen einen Tag vor dem Konzert erzählte, ist für ihn das Ziel das Erreichen einer grossen Harmonie der gesamten Truppe, die Perfektion im Concerto für Violine und Orchester. Dabei schwärmt er von der verstorbenen Lea. Anne-Marie, die Maestro Filipov sehr verehrt, erkennt, dass er nicht sie will, sondern ein Duplikat von Lea. Er wagt es aber offenbar nicht, ihr beim Essen zu erklären, wieso er auch sie unbedingt wollte. So resigniert er, kippt Wodka umd Wodka. Anne-Marie sagt ihr Mitwirken ab und geht verwirrt. So muss der Kontrabassist, der Andrey des öfteren moralisch aufbauen musste, die Initiative ergreifen und besucht Anne-Marie bei ihrer Ziehmutter, wo er nach dem anhaltenden Niet von Anne-Marie den sphingenhaften Spruch fallen lässt, ob sie nicht doch spielen wolle, sollte sie nach dem Konzert eventuell etwas über ihre Eltern erfahren können.
Damit kriegt er Anne-Marie rum und sie kommt ans Konzert. Als sie zu spielen beginnt, passiert das, was sich Andrey erhoffte – das noch disharmonische Orchester schwingt sich ein, der Glanz, die Perfektion, die Harmonie des gerühmten Bolschoi-Orchesters, erhebt sich über die grauen Häupter der Musiker und bringt die Qualität der Musiker, die Genialität Tschaikowskis Musik und das Spiel von Anne-Marie zum Überschwappen ins Publikum, das sich kindlich staunend dem Gehörten hingibt.
Denn Anne-Marie ist – Leas Tochter. Ein noch vor deren Deportation nach Sibirien entstandenes Baby wurde in den Westen geschmuggelt, wo es bei der Fluchthelferin aufwuchs, ohne je zu erfahren, wer ihre wahren Eltern gewesen sind und was ihnen widerfahren ist. Dieses Baby wuchs auf und wurde ebenfalls zu einer Starviolinistin – ohne ihr Erbe zu kennen. Andrey und viele Musiker kannten die Lebensgeschichte, denn Lea war ja eine von ihnen. Deshalb kamen sie alle, deshalb sprang die Magie von Anne-Maries Spiel sofort auf die Gruppe über.
Im Film werden während des Konzerts sowohl Retrospektive wie auch die amüsanten und erfolgreichen Konsequenzen dieser Familienzusammenkunft ineinander geblendet. Denn das ehemalige Bolschoi-Orchester wird als Filipovs Orchester berühmt und spielt in allen grossen Häusern dieser Welt. So hat auch dieses Märchen ein Happy End.
Mir hat der Film gefallen – wohl, weil ich eine russische Seele habe, wie mir mal attestiert wurde, weil mir die klassische Musik gefällt, weil mir Harmonie zwischen Menschen verschiedenster Art gefällt und weil ich immer gerne staune, wie das Gesamte mehr ist als die Summe der Einzelnen. Und wo als in der Musik kann man das besser erleben? Es ist kein Wunder, sprechen alle von der Musik als universelle Sprache. Denn wenn mehr als einer denselben Ton spielen sollen, müssen sie sich öffnen, für das gemeinsame Ziel, für das Spiel des anderen, für das Einpassen des Eigenen – in der Absicht, den Zuhörern etwas Schönes, Bewegendes, Verträumtes, Trauriges, Erheiterndes, Verzauberndes, eben mehr als nur den Klang eines Einzelnen anzubieten. In der Musik kann meines Erachtens ein Mensch sich am besten gehen lassen ... es duldet keine Diven wie im Sport ... denn wer sich nicht unterordnet, erzeugt sofort wahrnehmbaren Missklang.
Diese Fähigkeit des Menschen, sich für etwas Grösseres einzusetzen, sich einer Funktion in der Gruppe unterzuordnen, seine Egoismen wenigstens zeitweise sein zu lassen, die ist es, die mich bewegt. Da zeigt sich immer, dass ich halt doch sehr nah am Wasser gebaut bin ... wie man so schön euphemistisch sagen kann. Oder klarer gesagt: Das Einfühlen in diese grosse Fähigkeit des menschlichen Seins bringt mich regelmässig zum Heulen. Egal wo, egal bei welcher Gelegenheit ... denn darin verschwindet das Allein-Sein, das Getrennt-Sein, die Unsicherheit, die Angst. Dann ist es eins.